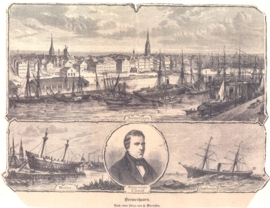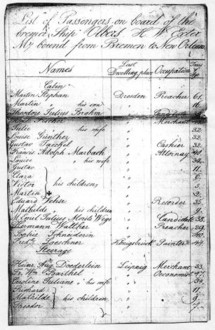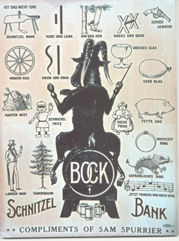Der
erste deutsche Fuß, der
in Nordamerika
Land betrat, dürfte kaum zu ermitteln sein. „Offiziell“ gelten 13
Familien aus
Krefeld als die ersten Deutschen, die nach Nordamerika, genauer nach
Philadelphia auswanderten. Dies war 1683, und seitdem waren die
englischen
Kolonien bzw. die späteren Vereinigten Staaten über drei Jahrhunderte
Ziel von
über 7 Millionen Deutschen, so dass in der Volkszählung
(Census) von 1980 jede(r) vierte
US-Bürger(in) Deutsche unter den eigenen Vorfahren beanspruchte.[5]
Allein im 19.Jahrhundert verließen 5,5 Millionen Menschen die deutschen
Staaten
und suchten in den Vereinigten Staaten von Amerika eine neue Heimat. [6]
Das
Jahr 1814/15, der Anfang des hier
beobachteten Zeitraumes, war ein bedeutendes Datum in der
amerikanischen
Geschichte, da sich die Vereinigten Staaten mit dem Ende des
sogenannten
2.Unabhängigkeitskrieges endgültig von England befreiten. Nun
existierte ein
freies, großes und aufstrebendes Land, das die in Deutschland zunehmend
durch
politische und vor allem ökonomische Missstände Bedrängten aufzunehmen
bereit
war. 1815 endeten die napoleonischen Kriege, und die Seeblockaden
wurden
aufgehoben, so dass im Jahre 1816/17 in Württemberg und Baden ein
erstes kurzes
Hoch in der Auswanderung nach Nordamerika mit 14. bzw. 20.000 Menschen
zu
verzeichnen war.[7]
Das
Jahr 1875 ist keine so eindeutige historische Zäsur. Sie ergibt sich
aus einem
vorläufigen Tief in den Auswandererzahlen und durch ein erstes
einschränkendes
Einwanderungsgesetz in den Vereinigten Staaten, das den Zuzug
bestimmter
Gruppen ausschloss: Prostituierte, zu Haftstrafen Verurteilte sowie
„unfreiwillige“ chinesische Kontraktarbeiter. Hiermit wurde der Wandel
hin zur
repressiveren Immigrationspolitik der 1880er Jahre eingeleitet. Des
Weiteren
lassen sich mit diesem Rahmenende die Auswirkungen des
deutsch-französischen
Krieges und der deutschen Reichsgründung (1870/71) in ihrer Bedeutung
für die
Auswanderung beobachten.
Im Verlauf dieser Jahre veränderten sich die wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse in den deutschen Staaten, in Europa und in den Vereinigten Staaten des Öfteren und mit ihnen die Auswanderungsbewegungen.
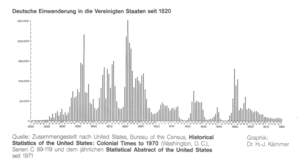 | 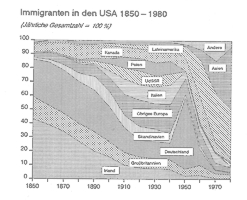 |
| Adams (1994) | Adams (1994) |
Die Hungersnöte in den Jahren 1814 bis 1817 bewirkten die erste „Auswanderungswelle von 1816/17“ im 19. Jahrhundert z. B. aus „den an den Oberrhein angrenzenden Ländern“ (Moltmann), so auch aus Württemberg und Baden, in die USA. Bevölkerungsvermehrung trieb viele der hier erbrechtlich als verpflichtend empfundenen und darum auch praktizierten Güterteilung wegen außer Landes, verschärft durch Unwetterkatastrophen (Das „Jahr ohne Sommer“: 1816), die wohl weitgehend verursacht wurden durch den Ausbruch des Vulkans „Tambora“ in Indonesien im April 1815. Günter Moltmann hat diese „Auswanderungswelle“ aus dem deutschen Südwesten vorzüglich dokumentiert. „Die Agrar- und Gewerbekrisen von 1845 bis 1848“ (Wehler 2), bestimmt durch Missernten, handwerkliches Überangebot und die das Handwerk bedrängende industrielle Produktion, verliehen der Auswanderung erneute Schubkraft, unmittelbar anschließend auch die (gescheiterte) Revolution von 1848/49. Die um die Mitte des 19. Jahrhunderts sich ausbreitende Industrie erfasste noch nicht den landwirtschaftlich bestimmten deutschen Nordwesten, den „finstern Winkel Deutschlands“ (Wechsler), so dass die „kurzlebige Rezession“ (Wehler 3) der frühen 1850er Jahre sich gerade auch hier auswirkte. Steigende Preise (Getreide verteuerte sich von 1850 bis 1855 um mehr als 100 %.) und niedrige Löhne machten die viel versprechenden USA attraktiv, weil Arbeitskräfte für die noch junge deutsche Industrie im regionalen Umfeld rekrutiert werden konnten. Die Jahre der Restauration (1815 bis 1848) und die der Reaktion (1850 bis 1862) haben vielen die weitgehend gescheiterte Revolution von 1848/49 angesichts ihrer politischen und wirtschaftlichen Erwartungen und Ansprüche als hoffnungsloses Zwischenspiel erscheinen lassen. Aktive Revolutionäre (1848er) haben einen auffälligen, aber doch nur kleinen Teil der Ausgewanderten von 1849 bis 1857 ausgemacht. Das waren eher „Europamüde“, denen die erneute restaurative Reaktion keine Perspektiven mehr bot bzw. zu bieten schien. Die in den USA durch spekulative Anleihen für Eisenbahngesellschaften und den Zusammenbruch der Ohio Life Insurance Company ausgelöste erste Weltwirtschaftskrise von 1857-1859 und der sich bald anschließende dortige Bürgerkrieg (1861 bis 1865) verringerten die Zahl der Ausgewanderten.[8]
| Kommentar zur Ermordung Abraham Lincolns am 14. April 1865. |
Da
die Auswanderungsmotivation stark von
den spezifischen regionalen Bedingungen geprägt war, soll ein kurzer
Überblick
für das Oldenburger Land gegeben werden.[9]
Während
des Untersuchungszeitraumes war es
ein souveränes Großherzogtum, das von der Nordseeküste bis ins
Münsterland
reichte und zudem über zwei Exklaven verfügte, die Fürstentümer Lübeck
und
Birkenfeld.
Politisch dominierte in dieser Zeit der aufgeklärte Absolutismus mit starker bürgerlicher Regierungsbeteiligung. Wirtschaftlich war das Oldenburger Land von der Land- und Seewirtschaft geprägt sowie durch den Handel, letzteres in wesentlich bescheidenerem Umfang als in der benachbarten Hansestadt Bremen, mit der es durch die Flussschifffahrt verbunden war. Die vorherrschende Religion war der Protestantismus, außer im katholischen Oldenburger Münsterland, im Süden des Herzogtums. Die Stadt Oldenburg als einziges Ober-Zentrum beherbergte innerhalb der engeren Stadtgrenzen (d. h. die heutige Innenstadt) eine Bevölkerung von ca. 13.000 (1864), das Herzogtum (ohne Lübeck und Birkenfeld) ca. 180.000 (1816) bis 250.000 (1875). Die Auswanderungsquote betrug im Mittel der Jahre von 1837-1873: 0,34% der Bevölkerung. Das war im Vergleich zu anderen deutschen Staaten eher gering. Die meisten Oldenburger wählten den naheliegenden Weg über Bremerhaven, um in die Neue Welt zu gelangen.[10]
Auswanderung aus dem Großherzogtum Oldenburg | |||||
| | Ges. AW | /Jahr | % Bev. | ||
| 1837-1846 | 7622 | 847 | 0,40 | ||
| 1846-1850 | 2773 | 792 | 0,35 | ||
| 1850-1855 | 3024 | 605 | 0,27 | ||
| 1871-1873 | 2510 | 837 | 0,34 | ||
| | | | | ||
| 1837-1873 | | 777 | 0,34 | ||
(gemittelt)
Bevölkerungszahlen:
1816: 182.213 / 1835: 207.891 /
1846: 222.811 /
1855: 232.950 / 1875: 248.136
(Eigene
Zusammenstellung anhand der ausgewerteten Oldenburger Presse)
Die berücksichtigten Zeitungen
Die Untersuchung beschränkt sich auf Zeitungen, die in der Stadt Oldenburg erschienen sind und läßt alle regionalen Zeitungen (bspw. aus Vechta oder Delmenhorst) außen vor, zum einen, weil nur so ein längerer Zeitraum erfasst werden konnte, zum anderen, weil die Neigung, „beim anderen abzuschreiben“, recht groß war. Auch die damals stark verbreiteten amtlichen Anzeigenblätter bleiben unberücksichtigt[11], da in ihnen keine Meinungsartikel zu finden sind. Einige berücksichtigte Zeitungen tauchen nicht in der Dokumentation auf, weil sie keine relevanten Artikel zur Fragestellung enthielten.[12] Die erfassten Zeitungen sind demnach folgende:
| Titel
[Abkürzungen] -
Titeländerungen |
Erscheinungsdauer
-häufigkeit | Charakter |
| Der
Beobachter [Beo] | 10/1844 – 1851: 2x
Woche 1852
– 05/1856: 3x
Woche | Nachrichten und Meinungen,
politisch progressiv, aber nach eigenen Angaben unpartheiisch
(Beo 1 v. 1844/10/01) |
| Humoristische
Blätter [HB] |
1838 – 1845: 1
x Woche | Unterhaltung |
| Neue
Blätter für Stadt und Land [NB] - Blätter für Stadt und Land | 1843 – 1851: 2x
Woche | Nachrichten, sehr Oldenburg bezogen
(s.u.) |
| Oldenburgische
Blätter [OLB] |
1817 – 1848: 1x
Woche | Unterhaltung, Nachrichten, Anzeigen |
| Oldenburger
Nachrichten [OLN] - Nachrichten für Stadt und Land - Oldenburger Nachrichten für Stadt
und Land - Oldenburger Nachrichten | 1863 – 09/1864: 2x
Woche 10/1864
– 07/1865:[13] 3x
Woche 1867
– 09/1870: 2x
Woche 10/1870
– (1943): 3x
Woche[14] | Nachrichten und Meinungen |
| Der
Oldenburgische Volksfreund [OLV] | 1849 – 07/1852: 2x
Woche | Unterhaltung und Nachrichten,
patriotisch (s.u.) |
| Oldenburgische
Zeitung [OLZ] - Oldenburger Zeitung | 1814 – 1847: 2x
Woche 1848
– 1851: 3x
Woche 1852
– 09/1862: 4x
Woche 10/1862
– 1893: täglich,
außer Sonn- und Feiertag[15]
| Kurznachrichtenblatt, später auch
Kommentar und Meinung, national-liberal
(s.u.) |
| Volkszeitung
für Oldenburg [VOL] | 04/1853 – 1857: 3x
Woche 1858: 2x Woche | Nachrichten und Meinung |
Die wichtigste
politische Zeitung war die Oldenburgische
Zeitung.[16]
Ihre Bedeutung zeigt sich auch darin, dass sie einer Vielzahl von
Regionalzeitungen
als Rahmen diente sowie viele bei ihr erschienene Artikel von anderen
übernommen wurden. Sie war die erste und lange die einzige Zeitung, die
täglich
erschien und die über einen längeren Zeitraum Bestand hatte. Ihrem
eigenen
Anspruch nach war die OLZ „national-liberal“
(OLZ 64 v. 1871/03/18) und bemüht „alle
Nachrichten von Bedeutung so schnell als möglich zu geben. Die
Redaction wird,
so viel es irgend möglich ist, nur wirkliche Thatsachen aufnehmen und
zwar
diese auch nur in möglichster Kürze oder in gedrängten Uebersichten,
doch so,
daß kein nur einigermaßen bemerkenswerthes Ereigniß den Lesern zu spät
oder gar
nicht bekannt werde.“ (OLZ 103 v. 1843/12/26) Ihre
Aufmerksamkeit
erstreckte sich auf Gesamtdeutschland und das Ausland, während der
Oldenburger
Teil nur geringen Umfang hatte.
Im Gegensatz
dazu steht „ein echt Oldenburgisches
Volksblatt, eine
Zeitschrift, welche […] ausschließlich oder doch vorzugsweise unsere
heimathlichen Interessen mit Ernst und Liebe einer freimüthigen
Besprechung
unterzieht, unsere eignen Zustände, Erfreuliches wie Unerfreuliches,
uns zum
Bewußtsein bringt, und so am ehesten geeignet ist, Vorurtheile und
Mißstimmung
zu entfernen, Gemeinsinn, Liebe zur Heimath und zum Vaterlande
hervorzurufen
und zu erhöhen“. So jedenfalls erklärte die Redaktion der Neue Blätter für Stadt und Land (NB 1
v. 1843/01/04) die Notwendigkeit ihres Erscheinens. Sie sollte „kein Parteiblatt, sondern ein Organ der
öffentlichen Meinung sein“. Der Bedarf für ein solches Blatt
kann allerdings
nicht all zu groß gewesen sein, denn die Zeitung hatte nur 9 Jahre
Bestand, ein
Schicksal, das sie mit
einer Vielzahl ihrer Konkurrenz teilte. In Deutschland hatten im
untersuchten
Zeitraum Zeitungen mit eher kritischem politischem Verständnis selten
eine
längere Lebensdauer.
Auch
Der
Oldenburgische Volksfreund, der dem Gedankengut der 1848er-Revolution
nahestand, fand offensichtlich wenig
Beifall. Lediglich drei Jahre konnte er dabei mitwirken „Wahnglauben
und Irrthümer zu zerstören, der Declamationssucht und der
Volksschmeichelei, dem Meinungsdespotismus und der Verdächtigungssucht
mit
aller Kraft entgegen zu treten, und dagegen in allen
Lebensverhältnissen das
Wahre und Rechte zu ermitteln, Belehrung und Aufklärung nach
gewissenhafter
Ueberzeugung und bestem Wissen nach allen Seiten zu verbreiten“.
(OLV 1 v.
1849/01/03)
Die
Oldenburger Zeitungslandschaft
Dass
Zeitungsartikel über die Auswanderung
und über das Zielland von potentiellen Auswanderern besonders
aufmerksam
wahrgenommen wurden, ist zu vermuten. Die endgültige Entscheidung hing
aber
wohl kaum davon ab. Auf jeden Fall war die Zeitung das Medium des
19.Jahrhunderts, das die öffentliche Meinung entscheidend prägte.
Entsprechend
waren die politischen Eliten bemüht, auf deren Inhalt Einfluss zu
nehmen. Eine
Vielzahl deutscher Staaten zensierte streng. Das Großherzogtum
Oldenburg war
jedoch sehr viel liberaler als andere Staaten.
In Oldenburg
erschienen Zeitungen
unterschiedlicher politischer Couleur, so dass ein breites
Meinungsspektrum
bestand. Da sich zudem die Zeitungen zahlreicher Informationsquellen
bedienten,
ist ihre Aussagekraft hinsichtlich eines allgemeingültigen Bildes
besonders
hoch. Sie berücksichtigten die Briefe von Ausgewanderten an die daheim
Gebliebenen, Berichte professioneller Reisender und die Agitationen von
Auswanderervereinen, Agenten und Werbern.[17]
Fest angestellte Korrespondenten wurden erst in den 1830er Jahren
beschäftigt,
natürlich zuerst von den großen deutschen Zeitungen. Zuvorderst ist für
Deutschland
die „Augsburger Allgemeine Zeitung“ zu nennen.[18]
Die Oldenburger Zeitungen nutzten deren Berichte ebenso wie die
englischer,
französischer und amerikanischer Zeitungen, so dass die politische
Berichterstattung der ersten Jahrzehnte eher einem Pressespiegel glich.
Auch
das Erscheinungsbild, zumindest der politischen Zeitungen, hatte
teilweise bis
in die 1850er Jahre diesen Charakter. Ohne thematische Überschriften,
geordnet
nach dem jeweiligen Herkunftsort der Quelle, verzichteten sie
weitgehend auf wertende
Artikel und beschränkten sich auf die möglichst aktuelle Wiedergabe von
Informationen.
Erst
Mitte der
1850er Jahre wandelte sich
die „Oldenburger Zeitung“ vom politischen Kurznachrichten-Blatt - zu
einer
„richtigen“ Zeitung mit eigenen Leitartikeln, verschiedenen Rubriken
und auch
mit mehr Werbung. Andere weniger von Aktualität und Informationen
abhängige
Meinungs- und Unterhaltungsblätter konnten diesen Schritt schon früher
machen.[19]
Hinsichtlich der
Aktualität war der
Standort Oldenburg durch seine Küstennähe durchaus im Vorteil. Man war
in der
Lage, sofort bei Ankunft in Bremerhaven und Brake Reisende und Kapitäne
zu
befragen und mitgebrachte Zeitungen zu erwerben. Die Nachrichten aus
Amerika waren zwar nur noch relativ aktuell, da die Verbindung nach und von
Europa zu
Zeiten der Segelschifffahrt mindestens 4 bis 6 Wochen betrug. Aber mit
Einführung regelmäßiger Dampfschifffahrtsverbindungen in den 1850er
Jahren
reduzierte sich diese auf ca. 2 bis 3
Wochen, um dann mit Einrichtung des transatlantischen
Telegrafen 1866
auf wenige Tage zu schrumpfen.
Infrastrukturelle
Einschränkungen
relativierten die Aktualität einer Nachricht, aber auch ihre
Verlässlichkeit
war fragwürdig, weil die Informationen häufig einer Zweit- bzw.
Dritt-Quelle
entnommen wurden.
Als
ein extremes
Beispiel für die
Nachrichtenkette, die manche Informationen durchliefen, soll eine kurze
Notiz
über den Grenzstreit zwischen Mexiko und Texas dienen:
„Oldenburgische
Zeitung“ No.103 vom 27.12.1842:
London den
17.Dec. (Ueber Frankreich). Aus New-York soll die Nachricht hier
eingegangen sein, daß Mexico die
angebotene Vermittelung der
Ver. Staaten in seinem Streite mit Texas zurückgewiesen habe. An der
Börse fand
diese Nachricht indeß wenig Glauben.
Zu
den technisch
bedingten Verfremdungen
einer Nachricht kam, nicht anders als heute, die persönliche
Interpretation
durch den Autor, so dass der Wahrheitsgehalt der Artikel äußerst fragwürdig ist.[20]
Die Aussagekraft hinsichtlich der Wahrnehmung und der politischen Intention des
Zeitungsschreibers bleibt
jedoch ungebrochen, sie wird eventuell sogar verstärkt.
Die
allgemeine
Auswanderungsdiskussion
In
den 1830er
Jahren wurde aus einer
temporären und regionalen Auswanderung eine Massenbewegung, die nach
und nach
sämtliche deutsche Staaten erfasste. Die Oldenburger Zeitungen
berichteten bis
dahin sehr vereinzelt über Auswanderungen aus anderen Staaten und dies
zumeist
im Kleingedruckten; z. B.:
„Oldenburgische Zeitung“ No.
53 vom
02.07.1830:
Die Auswanderungslust hat in
der Provinz Starkenburg (Darmstadt) so wenig ihre Gränzen erreicht, daß
sie im
Gegentheil eher zu wachsen, als abzunehmen scheint. Am 8.Juni kamen 86
Auswanderer aus der Bergstraße durch Darmstadt; sie führten viel Gepäck
mit
sich. Am 10. früh folgte ein zweyter Transport aus dem Landgericht
Lichtenberg
im Odenwalde, wo die Auswanderungslust ebenfalls sehr rege ist. Es
waren 77
Personen, welche einige und zwanzig Wagen mit sich führten; Männer und
Frauen
im kräftigsten Alter, dickwangige Knaben und blühende Mädchen bildeten
den Zug.
Alle schienen freudig ihrem neuen Vaterlande, den vereinigten Staaten
von
Nord-America, entgegen zu gehen.
Oldenburg
selbst
war auch längst nicht in vergleichbarem
Maße betroffen, und den Oldenburger Zeitungen war daran gelegen, diesen
Umstand
des Öfteren zu betonen. In der Fußnote zu einem ansonsten relativ
uninteressanten „Auszug eines Briefes aus
Amerika“ (OLB 45 v. 1833/11/05)[21]
wird dies deutlich: „Dieser Brief ist
zwar schon ziemlich alt und enthält wenig Interessantes für die
gewöhnlichen
Auswanderungslustigen, allein der Einsender hat ihn doch im Auszuge
mittheilen
wollen, da er einige Striche zur Schilderung des Lebens eines
amerikanischen
Landgeistlichen enthält. Der Verfasser wanderte nemlich im Jahre 1791,
als
Candidat der Theologie aus, weil ihm in seinem Vaterlande, (er war kein
Oldenburger) die Aussicht auf Anstellung genommen war.“
Noch
1832
behaupteten die „Oldenburger
Blätter“, dass „noch kein Oldenburger
ausgewandert“ sei. (OLB 3 v. 1832/01/17) Dieser Aussage lag
jedoch ein
eigentümliches Verständnis dessen, wer ein Oldenburger sei, zu Grunde;
alle
bisher Ausgewanderten stammten eben nicht aus der „Stadt“ Oldenburg und
ihrer
näheren Umgebung, sondern vor allem aus dem Süden des Herzogtums, d.h.
vor
allem aus den Ämtern Vechta und Damme, Steinfeld, Löningen und
Cloppenburg.
Dies sollte sich auch in den folgenden Jahren nicht ändern. Die
Auswanderung
aus dem Amt Damme betrug z. B. nahezu das Zehnfache der Auswanderung
aus der
Stadt Oldenburg.[22]
Die Politik der
deutschen Staaten in den
Anfangsjahrzehnten des 19.Jahrhunderts war geprägt von dem Wunsch,
Auswanderung
zu begrenzen, häufig mit dem Mittel des Verbotes und der
Ausreiseverweigerung.
In Preussen war beispielsweise die „Anstiftung zur Auswanderung“ noch
1843 ein
Straftatbestand. Auch die Berichte über Not und Elend der
Ausgewanderten, über
Schiffsunglücke und Strapazen auf der Überfahrt sowie die Warnungen vor
Ausbeutung durch Agenten sind sicherlich zu großen Teilen der
Einschätzung
zuzuschreiben, dass Auswanderung in hohem Maße einen Verlust
darstellte. Der
Versuch der Abschreckung und des Verbots war aber ebenso wenig
erfolgreich wie
der beispielhafte lyrische Appell an den Patriotismus:
„Oldenburgische Blätter“ No. 42 vom 15.10.1833:
An
die
Auswanderer.
Ein Paradies dort über’m Meer?
Was drängt, der Zukunft unbewußt,
Euch von der Heimath Mutterbrust?
Es mag der träge Bürger ziehn!
Dem Fleiß kann hier auch Segen blühn;
Hier, wo es nicht an Land gebricht,
Giebt es auch Uebervölkrung nicht.
[…][23]
Der bleibt dem Deutschen lieb und werth,
Und was er drinnen wirkt und schafft,
Bewährt des Deutschen innre Kraft.
Geknüpft an Fürst und Vaterland,
Steht er mit alter Deutscher Treu
In allen Stürmen kräftig bey,
Und weicht vom Vaterlande nicht,
Weil er, bey trüber Gegenwart,
Auf bessre Zukunft ruhig harrt.
Blickt stets sein Fleiß vertrauend hin;
Er spricht, baut es sein täglich Brod:
Den guten Fürsten segne Gott!
Ein ächter Deutscher immerdar;
Wer nicht zu diesen sich gesellt,
Mag ziehen in die neue Welt!
Nach und nach setzte sich der Gedanke durch, dass nur „träge Bürger ziehn“ (s.o.) und die Auswanderung „als ein wahrer moralischer Gewinn für die Gesellschaft zu betrachten“ sei. (OLZ 56 v. 1834/07/15) Anders formuliert, stellte sich die Auswanderung als soziales Ventil für wirtschaftlich und politisch schwache Gesellschaften dar. Dies führte dazu, dass einige Staaten, z. B. auch das Königreich Hannover, Auswanderung wohlwollend duldeten, also Auswanderungspolitik betrieben und in diesem Kontext auch gern Insassen ihrer Armen- und Arbeitshäuser und Gefängnisse sowie politische Gegner verschickten, allerdings mit der Auflage, im Falle der Rückkehr wieder inhaftiert bzw. im Armenhaus untergebracht zu werden. Nicht zuletzt Hannover hat sich dabei hervorgetan, begünstigt durch die unmittelbare Nachbarschaft zu Bremen/Bremerhaven. Hannover hat aber auch den auf eigene Kosten Auswandernden die Staatsbürgerschaft bis zur Einbürgerung in den USA (frühestens 5 Jahre nach der Ankunft) belassen, während z. B. Preußen zum Zeitpunkt der Auswanderung die Staatsbürgerschaft entzog, Rückkehr in die Heimat also vom Wohlwollen der Behörden abhängig machte. So konnten Auswanderung und Rückkehr erschwert werden[24]. Zunehmende Klagen über die Ausbeutung ihrer Staatsangehörigen durch skrupellose Geschäftemacher unter den Auswanderungsagenten und immer häufigere Beschwerden aus Auswanderungshäfen bzw. aus den Zielländern über völlig mittellos gestrandete Auswanderer führten zur Einrichtung einer geregelten Infrastruktur und Gesetzgebung, ohne dass die „Auswanderungsfreiheit“ der (revolutionären) Paulskirchenverfassung (§ 6, Art. I) verbindliches Reichsgesetz hätte werden können. Die Revolution war schon gescheitert, als die „Constitutionelle Nationalversammlung“ noch die „Ausführungsbestimmungen“ diskutierte.[25] Auch begann diese ein gutes Geschäft zu werden. So gut, daß schließlich Auswanderungshäfen wie Bremen und Hamburg sich beklagten, wenn die Auswanderung rückläufig war oder andere Häfen bevorzugt wurden. Beispielsweise verhandelte die Stadt Bremen 1875 mit dem Norddeutschen Lloyd über Möglichkeiten, die Auswanderung über ihren Hafen zu steigern, da die gesunkenen Auswandererzahlen 1874 bereits zu Verlusten im Personen- und Handelsverkehr nach den Vereinigten Staaten und zu sinkenden Aktienkursen geführt hätten. Der ökonomische Aspekt wurde auch in den Zeitungen berücksichtigt, in denen ab den 1850er Jahren regelmäßige Werbeanzeigen für Auswanderungsüberfahrten erschienen.
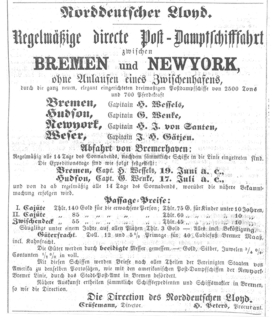 |
| Anzeige des Norddeutschen Lloyd von April - Juni 1958 in der Oldenburgischen Zeitung (OLZ) |
Die
Verödung
ganzer Landstriche, der
allmählichen Mangel an Arbeitskräften und wehrfähigen Männern und der
Abfluß
von beträchtlichem Vermögen, als nicht mehr nur Bedürftige
auswanderten, führte
auch zu der Überzeugung, dass die Ursachen für die Auswanderung und
nicht, wie
zuvor, die Auswanderer bekämpft werden müssten.
„Oldenburger
Zeitung“ No. 167 vom
14.10.1862:
In der
„Reform“ fragt ein mecklenburgischer Amtmann einen Dorfschulzen:
„Welches
Mittel kann man wohl anwenden, um die Auswanderung
der Mecklenburger nach Amerika zu hemmen, die leider immer
mehr überhand
nimmt?“ Der Dorfschulze antwortet: „Dat geiht ganz licht. Setten Se man
int
Blatt, dat Amerika mecklenborgisch worden ist – da geiht keen Mensch
mehr
rüber.“
Diese
Glosse verweist auf eine Ursache für
die Auswanderung, nämlich die staatliche Repression, auf welche die
Oldenburger
Zeitungen mit viel Häme reagieren konnten, da es ihrer Überzeugung nach
im
Herzogtum keinen Anlaß für Klagen geben konnte, ganz im Gegensatz zu
anderen
deutschen Staaten. Besonders eindrücklich zeigt dies ein Artikel in der
„Volkszeitung für Oldenburg“ No.93 vom 02.11.1853:
Der
Musterstaat Kurhessen
Im
deutschen
Musterstaat, Kurhessen, geht es etwas sonderbar zu.
[…][26]
Das
einzige Glück
des kurhessischen Volkes scheint im Auswandern zu liegen, aber die
Verfassung,
wenigstens die Gesetzgebung, will auch dieses Glück möglichst aufheben
und es
sind deshalb Reskripte erschienen, die so zu sagen Auswanderungs-Spione
anstellen, auf deren Angabe Jedermann in Kurhessen, wenn er über die
Grenze
reisen will zurückgehalten und heimtransportirt werden kann.
Es läßt
sich
aber auch nicht leugnen, daß Grund zu diesem Reskript vorhanden ist.
Auswärtige
Zeitungen haben schon öfter behauptet, daß aus Kurhessen ganze
Dorfschaften
ausgewandert sind, was von Hassenpflugschen Zeitungen als Uebertreibung
angegeben wurde. Jetzt jedoch stellt sich die Wahrheit der Thatsachen
ganz
unbestreitbar heraus. Es sind nicht nur ganze Dorfschaften
ausgewandert, sondern
die leer stehenden armseligen Hütten der Bauern wurden in einzelnen
völlig
verlassenen Dörfern jetzt niedergerissen und die Stätten der
Geflüchteten in
Felder umgewandelt.
Wenn
solche
Thatsachen nicht für das Glück der Hassenpflugschen Regierung sprechen,
so
giebt es keine Beweise von Volkesglück mehr. Es verdienen diese
Thatsachen, daß
man sie öffentlich dokumentire, damit nicht spätern Zeiten gerechte
Zweifel
darüber erhoben werden mögen, ob wirklich im Herzen Deutschlands in der
Mitte
des zivilisirten neunzehnten Jahrhunderts dergleichen gemeinsames
Fliehen aus
dem Vaterlande möglich war. Ob wirklich solche Zustände existiert
haben, daß
sie im Volke die Natur umkehrten und die natürliche Liebe zur
heimathlichen
Scholle, in Verachtung und Haß gegen dieselbe umzuwandeln im Stande
waren.
[...]
In der
That,
es ist charakteristisch, das solch‘ ein Zustand in Kurhessen eintritt:
Entvölkerung nach der Volksbeglückung, und Eides und Treubruch und
Unzucht und
Defraudation in den Reihen der Treubündler des beglückten Musterstaates.
(B.Z.)
Auch
die
religiöse Unfreiheit in
verschiedenen Staaten galt als eine Motivation für die Auswanderung,[27]
welche jedoch ebenfalls in Oldenburg wenig Bedeutung hatte.
Der mit Abstand
wichtigste Schubfaktor war
jedoch die ökonomische Situation in Deutschland, und sie war auch für
Oldenburg
entscheidend. Hierzu gehörten Extremsituationen wie die Notstände in Süddeutschland 1814-17,
die Krisen von
1845-1848, die Revolution 1848/49 und die Rezession zu Beginn der
1850er Jahre,
aber auch wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen wie die Abgabenhöhe,
das
Niederlassungsrecht und die Gewerbefreiheit. Vor allem letztere
forderte eine
Reihe von Autoren als Maßnahme zur Verringerung der Auswanderung aus
Oldenburg;
z.B.:
„Neue
Blätter für Stadt und Land“ No. 51 vom 26.06.1847
[Leitartikel] Einiges
über Auswanderungssucht.
Wenn gleich nicht zu
verkennen ist, das Viele der aus unserm Lande Auswandernden durch
lockende
Briefe, falsche Vorspiegelungen gewissenloser Leute, glänzende
Schilderungen des
Glückszustandes ihrer Angehörigen (die selten der Wahrheit getreu
sind),
bewogen werden, ihr Vaterland zu verlassen und sich nach Amerika
überzusiedeln,
so sind dieses doch nicht die Hauptmotive zur Auswanderung. Der Drang
sich eine
bessere Existenz zu verschaffen, selbst dann, wenn keine ganz
ungünstigen
Verhältnisse vorliegen, ist jedem Menschen eigen, und somit läßt er
Nichts
unversucht, was diesem Drange Befriedigung zu gewähren scheint. Je
beschränkter
aber der Wirkungskreis ist, worin er sich zu bewegen hat, je ungewisser
sind
seine Aussichten, das vorgesteckte Ziel in der Heimath zu erreichen;
und um so
weniger hat man sich zu wundern, wenn der für sein Glück thätige Mann
Amerika
gegen sein Vaterland vertauscht, da in den Freistaaten die
Gewerbefreiheit
jeden unternehmenden Kopfe Gelegenheit an die Hand giebt, auf eine oder
andere
Art sein Heil zu versuchen. Gelingt Manches nicht, so hat er darum
nicht zu
verzagen, es bleibt ihm ja der Weg offen, sich anderswo umzusehen, oder
ein
Anderes zu versuchen, indem er für sein Geld ein Patent zu jeglichem
Geschäfte
erhalten kann.
Wie ganz umgekehrt ist es
hier aber im Oldenburgischen. Bleiben wir zum Beispiel beim Handwerker
stehen.
Ein solcher wünscht sich zu etabliren, hat seine Lehrjahre
durchgemacht, sich
auf Reisen vervollkommnet, das gehörige Betriebscapital nachgewiesen,
der
Militairpflicht genügt und das großjährige Alter erreicht; mithin kann
ihm die
Handwerks-Verordnung nicht entgegen stehen, und er ist glücklich in der
Hoffnung, seinen heiß ersehnten Wunsch nicht abgeschlagen zu sehen. O!
zu
voreilige Freude! – Wäre es dir, glücksuchender Mann, bewußt, welche
Hindernisse dir noch entgegen treten können, ehe du deinen Zweck
erreichst,
gewiß du würdest deine Freude um ein Bedeutendes herabstimmen. Mit der
Einreichung deines Gesuches um Aufnahme als Meister bei dem
betreffenden Amte,
fällst du erst der Gunst deines Amtmanns anheim. Dieser wird, im Fall
du dich
solcher nicht zu erfreuen hast, seinen Bericht an die Regierung so
einzurichten
wissen, daß deine Eingabe mit dem gewöhnlichen, aber inhaltschweren
Worte:
„auf das Gesuch kann nicht
eingetreten werden.“ zurückgewiesen wird. Legst du deshalb nun auch
Recurs ein,
es wird dir selten helfen. Fordert die obere Behörde einen Bericht, so
wird
dieser natürlich so gestellt, daß er die abgegebene Resolution ganz
rechtfertigt. Durch welche Mittel wird sie aber gerechtfertigt? –
Wodurch wäre
allen diesen Plackereien vorzubeugen? Antwort: durch
Gewerbefreiheit. Die in ihrem alten Rechte sitzenden
Gewerbetreibenden würden freilich über Ueberfüllung des Gewerbes durch
die
Gewerbefreiheit schreien, jedoch was thuts? Mag doch Jeder zusehen, wie
er
durch billige humane Behandlung der Eingesessenen sein Brod sichert und
mit den
Mitarbeitern in seinem Fache gleichen Schritt hält. Ist doch der
Gewerbestand
nicht da, damit nur die Ausübenden Nutzen ziehen, nein! des allgemeinen
Wohles
wegen. Geben uns doch andere Staaten den Beweis, daß sich
Gewerbefreiheit mit
den Interessen der Unterthanen bestens verträgt, warum sollen wir
länger den
Ansichten und oft Launen der Beamten ausgesetzt sein, die durch ihre
Machtsprüche uns das Lebensglück zerstören oder erhalten können, je
nachdem wir
verstanden haben, ihre Gunst zu erlangen, oder den graden Weg gehend,
solche
verscherzt haben. Gebt uns Gewerbefreiheit, und nochmals sei es gesagt,
die
Unannehmlichkeiten haben ein Ende.
[…][28]
Es wäre ein Leichtes mehrere
Verhältnisse nachzuweisen, wo es klar wurde, daß das Vorhaben
verschiedener
Personen sich eine Erwerbsquelle zu verschaffen, an dem
Entgegenarbeiten des
Beamten scheiterte.
Auf unsern anfangs erwähnten
Gegenstand, nämlich die Auswanderung nach Amerika, zurückkommend,
bemerken wir
noch, daß eben die Unsicherheit, sich im Vaterlande selbstständig
niederlassen
zu können, Viele veranlaßt auszuwandern; denn wie Mancher unterliegt
dem
einseitigen Gutfinden der Behörde, obgleich er die Mittel besitzt, sich
einen
eigenen Heerd zu gründen! Von Eltern, die ungern das ihnen sonst theure
Vaterland verlassen, und gerne zu den Gebeinen ihrer Voreltern gebettet
werden
möchten, hört man immer nur die Klage: „wir hätten hier noch wohl zu
leben,
aber unserer Kinder wegen müssen wir auswandern, denn diesen bleibt,
wenn sie
sich einem Geschäfte widmen, für die Zukunft nur die Ungewißheit, ob
sie sich
in ihrem Kirchspiele selbstständig niederlassen dürfen. Uns belehrte
die
Erfahrung, daß enorme Schwierigkeiten zu überwinden sind, und will man
im
eigenen Kirchspiel die Kinder nicht wirken lassen, wenn sie Männer
geworden;
wieviel weniger wird es ein fremdes thum.“*) Den Eltern wie den Kindern
ist es
aber darum zu thun, daß letztere nicht auf die Handthierung der
Ersteren
beschränkt sind und in deren Fußstapfen treten müssen,
nein! sie wollen eine bessere Existenz, und können sie
solche in ihrem Vaterland nicht finden, muß Amerika den Ausweg zeigen.
Wer
wollte wohl diesen Leuten unter solchen Umständen das Auswandern
verdenken!
[…]
Alles das vorhin Gesagt
zusammen genommen, muß uns in der Ansicht bestärken, daß die
Erwerbszweige der
Unterthanen im Herzogthum Oldenburg zu beschränkt sind; man gebe uns
Gewerbefreiheit und Wenige werden fortan ihr Vaterland mit Amerika
vertauschen
wollen.
D., im Mai
.....s.
*) Es ist
bezeichnend für unsern Zustand – sagt Immermann (Memorab. I. S.111) -,
daß
deutsche Eltern in den Kindern die Zukunft zu erblicken pflegen, und
zwar die
Segnungen derselben, welche ihnen versagt blieben.
A.d.R.
In
diesem
Zusammenhang wurde, wie auch
oben, immer wieder auf die Vereinigten Staaten als Vorbild verwiesen.
Insbesondere die mangelnden Chancen, in der Landwirtschaft zu eigenem
Besitz zu
gelangen, wurden beklagt und die Aufteilung der Großgrundbesitze bzw.
die
Kolonisierung der brachliegenden Moorgebiete gefordert, welches nach
und nach
auch von der Regierung realisiert wurde.
Die Auswanderung
wurde durchaus
differenziert betrachtet, nicht nur innerhalb des gesamten
Meinungsspektrums.
Oft stellte ein Autor sowohl die positiven als auch die negativen
Seiten dar.
Mit Bedauern wurde jedoch immer wieder die verpasste Chance betont,
dass mit
der Vielzahl der Auswanderer eine blühende deutsche Kolonie gegründet
werden
könnte, wenn es nur gelänge, die Wanderungsbewegungen entsprechend zu
steuern.
„Oldenburger Zeitung“ No. 106 vom
08.07.1858
Julius Fröbel, über deutsche
Auswanderung.
(Beschluß) [29]
[…]
In
allen
Beziehungen aber, den national-ökonomischen wie den politischen,
entspricht die
deutsche Auswanderung auch nicht entfernt den Erwartungen, welche
Deutschland
von den vortheilhaften Rückwirkungen eines solchen Menschenbeitrages
zur
Bevölkerung und Cultivirung außereuopäischer Länder unter anderen
Verhältnissen
hegen dürfte. Die deutsche Nation sendet eine Menschenmenge aus, welche
hinreichend ist, der nordamerikanischen Union in jedem Jahre einen
neuen Staat
hinzuzufügen, - sie sendet eine Menschenmenge aus, welche hinreichend
wäre, in
zehn Jahren Central-Amerika in ein deutsches Land zu verwandeln. Von
den
national-ökonomischen und politischen Folgen, die ein solches Resultat
nach
sich ziehen würde, ist natürlich unter gegenwärtigen Umständen kaum ein
Schatten zu spüren. Wirft man also die Frage auf, wodurch Deutschland
um einen
so großen Theil der ihm aus seiner Auswanderung eigentlich zukommenden
Vortheile betrogen wird, so ist die Antwort einfach: Dadurch, daß die
deutsche
Auswanderung, anstatt sich an passendem Orte zu eigenen Kolonien zu
sammeln,
sich unter anderen Bevölkerungen zerstreut.
Unter anderem zu
diesem Zweck wurde eine
Vielzahl von Auswanderungsvereinen gegründet mit Kolonisationszielen in
verschiedenen Weltgegenden, auch in Osteuropa und Afrika, vor allem
aber in
Süd- und Nordamerika, hier beispielsweise die Adeligen-Kolonie in Texas.
Diese
Vereine
und Gesellschaften arbeiteten
mit unterschiedlichen Schwerpunkten in vielfältigen Bereichen. Sie
vermittelten
im Heimatland die Schiffspassage, erleichterten die notwendigen
Behördengänge
und den Verkauf der zurückgelassenen Güter sowie den Ankauf von Land in
den
Zielländern und unterhielten in den Auswanderungshäfen die sogenannten
Auswanderungshäuser, in denen die Wartezeiten bis zur Abfahrt
überbrückt werden
konnten. Vor Ort, d.h. im Zielland, dienten sie als Anlaufstellen und
Kontaktbörsen für die Einwanderer und berieten diese in sämtlichen
Lebenslagen.
Sie veröffentlichten Publikationen und Zeitungen zum Thema Auswanderung[30],
regelmäßige Berichte über die Höhe der Einwanderung und die Situation
im
Einwanderungsland, z. B. über den aktuellen Arbeits- und Berufsbedarf,
sowie
allgemeine Ratgeber für die Auswanderer. Vieles hiervon, insbesondere
Warnungen, findet sich in den Zeitungen wieder.
Das
Amerikabild im
Besonderen
Größere
Bedeutung in der
Presseberichterstattung bekamen die Vereinigten Staaten erst in den
1830er
Jahren, während sie zuvor nur vereinzelt oder mit Kurznachrichten und
im
Vermischten präsent waren. Dies gilt für die gesamte deutsche Presse,
was
beispielsweise dadurch deutlich wird, dass die „Augsburger Allgemeine
Zeitung“
erst 1833 eine eigene Rubrik für die Vereinigten Staaten einrichtete,
während
diese zuvor unter „Amerika“ eingeordnet wurden.[31]
In diesem Zeitraum wurde ebenfalls eine Vielzahl von Spezialzeitungen
zu
Amerika gegründet.[32]
Ein Zusammenhang mit der gesteigerten Auswandererzahl scheint
offensichtlich.
Eine weitere Ursache hierfür ist aber sicherlich auch die Entwicklung
der Vereinigten
Staaten zu einer Weltmacht, die sich zunehmend in europäische Belange
einmischte. Während noch 1814 eine englische Zeitung den Krieg mit den
Vereinigten Staaten als unbedeutend im Vergleich mit den europäischen
Belangen
einstufte,[33]
wurde 1853
bei der Koßta-Affäre deutlich, welches Gewicht diese in der
Zwischenzeit
erlangt hatten. Die Verhaftung des Ungarn Koßta in der Türkei durch die
österreichische Regierung führte zu schweren diplomatischen
Verwicklungen, da
die Vereinigten Staaten Koßta, der 1851 einen Antrag auf Einbürgerung
gestellt
hatte, als Staatsbürger betrachteten. Überdies nutzten sie die
Möglichkeit,
sich als Schutzmacht der Türkei zu profilieren. Die „Volkszeitung für
Oldenburg“ zitierte den russischen Zaren mit der bezeichnenden Aussage:
„Sagen Sie dem Kaiser von Oesterreich, daß,
je rascher er die Sache fallen läßt, es desto besser für ihn ist; die
Amerikaner werden schnell genug herüberkommen, man braucht sie nicht
erst
einzuladen.“ (VOL 80 v. 1853/10/02) Das Ergebnis war die
Freilassung und
Abschiebung Koßtas nach Frankreich.[34]
Während des
amerikanischen Bürgerkrieges
war das Interesse schon
so groß, dass
es möglich ist, diesen bis in die Frontverläufe allein durch das
Studium der
täglichen Zeitungsartikel zu verfolgen. Seine Bedeutung schätzte ein
Reporter
der „Wiener Presse“ als „das größte
Ereignis, welches sich in dem halben Jahrhundert zugetragen hat, das
dem Wiener
Congresse folgte.“ (OLN 63 v. 1865/05/28)[35]
Für die Oldenburger Zeitungen handelte es sich einhellig um einen Kampf
für die
Freiheit und gegen die Sklaverei,[36]
dessen Ergebnis auch in Europa von Bedeutung sein sollte: „Fortan tritt in alle politischen Verhältnisse ein
neues Element, die
gewaffnete, siegreiche Demokratie.“ (OLZ 108 v. 1865/05/10)[37]
Diese Einschätzung kann durchaus als Warnung an die eigenen Regierungen
in
Deutschland interpretiert werden und verweist auf eine weitere
entscheidende
Ursache für die Attraktivität der Vereinigten Staaten als
Zeitungsthema: der
Umstand, dass das dortige Geschehen und die Verhältnisse dazu dienen
konnten,
die Bedingungen und die Politik in der eigenen Heimat zu kritisieren,
ohne
zensiert zu werden.
Dass es nicht
ohne Widerspruch bleiben
konnte, wenn die Vereinigten Staaten dem „Vaterland“ als Vorbild bzw.
als
Spiegel präsentiert wurden, liegt nahe, wenngleich sich der
herausgeforderte
Patriotismus mitunter bis ins Obskure verstieg. So provozierte eine
rein
botanische „Beschreibung der in
Nordamerica befindlichen dreyerlei Eichenarten“ (OLB 50 v.
1829/12/15) die
mit der Frage endete, ob deren Anbau auch in Deutschland empfehlenswert
wäre,
eine empörte und sehr umfangreiche Erwiderung, die in der Essenz
gipfelte: „Wenn es in unserer Gegend bloß auf
die Bäume
[…] ankäme, so möchte ihre Anzucht etwas für sich haben; allein hier
entscheidet
der innere Werth die Anzucht, und in Betreff dieses sind sie unseren
Eichen
nicht gleichzustellen“. (OLB 30 v. 1830/07/27)
Dieses
Muster
der kontrastierenden
Berichterstattung zieht sich in unterschiedlicher Gewichtung, je nach
politischer Ausrichtung der Zeitung, durch sämtliche Themenbereiche und
über
die gesamte Zeitdauer.
Als besonders
attraktiv und als
nachahmenswertes Vorbild wurden in der Regel die bürgerlichen
Freiheiten und
die politische Gleichheit in den Vereinigten Staaten hervorgehoben.
Bezeichnend
ist die kurze Geschichte im „Vermischten“ der „Oldenburger Zeitung“
No.243 vom
17.10.1865:
Eine noch unbekannte Lincoln-Anekdote
bringt die Bresl.Ztg.:
Ein preußischer Lieutenant, der wegen Schulden sein Vaterland und
seinen Dienst
hatte verlassen müssen, wußte sich eine Audienz bei dem Präsidenten
Lincoln zu
verschaffen und erhielt, da er im Uebrigen ein intelligenter und
anstelliger
Mann war, die Zusicherung einer Lieutnantstelle in einem
Reiterregiment.
Hierüber ganz entzückt, glaubte er schließlich auch nicht verschweigen
zu
müssen, daß er einem der ältesten preußischen Adelsgeschlechter
angehöre. „Oh“
sagte der alte Abraham, „das wird Ihnen in Ihrem Fortkommen hier gar
nicht
hinderlich sein.“
Ebenfalls
hervorgehoben wurde die religiöse
Freiheit in den Vereinigten Staaten, im Gegensatz zu den
Einschränkungen, die
in vielen deutschen Staaten beklagt wurden. Aber auch dies wurde in den
Zeitungen nicht nur positiv gesehen:
„Neue Blätter für Stadt und Land“
No. 27 vom
07.04.1849
Amerikanische Zustände.
Der
treffliche
Verfasser des „deutschen Protestantismus“, eines Buches, in dem uns der
treueste Spiegel unsrer Sünden und Schwächen vorgehalten wird, Friedr.
Hundeshagen, sagt in einer kleinen Broschüre: Das deutsche Parlament,
über die
Nord-Amerikaner, unter denen er zehn Jahre gelebt, Folgendes:
Wir finden in den Vereinigten Staaten, deren Bevölkerung ehemals fast ausschließlich aus streng religiösen, rechtlichen Bewohnern bestand, wenig, fast keine Treue, keinen Glauben mehr, wir finden zwei, wenn nicht drei Fünftheile der Bevölkerung in völliger Unbekanntschaft mit dem Christenthum, wirklich existirt die Kindertaufe dort gar nicht, auch nicht bei den Sekten, daneben sehen wir religiöse Heuchelei und Fanatismus.
[…]
Man gab zuerst die Religion
frei, statt festzusetzen, es müsse jeder einer kirchlichen Gemeinde
angehören,
welcher er auch wolle, und eine religiöse Erziehung erhalten. Daraus
folgte
Heidenthum und Ruchlosigkeit; denn wo keine Religion, ist auch kein
Eid, kein
Recht.
[…][38]
Als
religiöse
Gruppe wurden vor allem die
Mormonen negativ dargestellt, mit heftigster Kritik an der Polygamie,
aber auch
an den Bemühungen um politische Unabhängigkeit und eigenständige
Gesetzgebung
in den Mormonensiedlungen in Utah.[39]
Eine zu große staatliche Sorglosigkeit wurde gegenüber den
Machtansprüchen der
katholischen Kirche beklagt.[40]
Verschiedene religiöse Ausprägungen wurden jedoch nur belächelt, zum
Beispiel
die Ausbreitung des Hexenglaubens in Pennsylvania (OLZ 52 v.
1853/04/03), das
Auftreten einer „Negerin als Messias“ (OLZ 34 v. 1847/04/27) oder die
Zunahme
des Spiritismus:
„Der
Beobachter“ No. 126 vom 26.10.1852
Amerikanische Geisterseher.
Es ist für die geistige Entwicklung
der amerikanischen Bevölkerung ein sehr beschämendes Zeugniß, daß die
Secten
der Spiritualisten oder Geisterseher sich täglich vermehren, selbst
unter den
besseren Classen der Gesellschaft Proselyten werben, mit ihrem Wahnsinn
auf
offenem Markte auftreten, und mit demselben eigene Journale füllen. Am
30. des
vorigen Monats hielten sie längst angekündigtes Meeting in Worcester,
und die
Scenen, die dabei auftauchten, wären selbst für ein Irrenhaus noch zu
barok
gewesen. Zuerst wurde ein Mr.Davis der Versammlung vorgestellt, als ein
Mann,
den der „Geist“ zu wiederholten Malen mit einem Besuche beehrt hatte,
und der
einen getreuen Bericht über seine Zwiegespräche mit dem „Geiste“
abzustatten
bereit sei. Der Fall war selbst für diese Versammlung, die doch
ohnedies aus
lauter Geistersehern bestand, abnorm, denn Mr.Davis erzählte, er sei,
wie
Keiner vor ihm, so glücklich gewesen, einen ganzen Geistercongreß
gesehen zu
haben.[…][41]
– Ein
anderer Namens Mr.Hewitt las eine Mittheilung von J.Hancock’s
Privatgeist,
bestätigt durch die Privatgeister der Herren Washington, Franklin,
Henry u.s.w.
Darin wird Mr.Spear als eine Art von Heiland der sündigen Welt
angekündigt.
Dazwischen rief eine Frau von der Gallerie, die auch viel mit Geistern
zu thun
hatte: O könnte ich meine Erlebnisse seit meinem zwölften Jahre
verkünden! Thut
Buße, denn der letzte Tag bricht an! Dann erhob sich ein breitmäuliger
Schotte
und rapportirte, eben sei Mr.Hancock’s Geist bei ihm gewesen und habe
sich über
einige Unrichtigkeiten in dem zu Anfang der Sitzung vorgelesenen
Berichte
beschwert. Eine Dame las eine Mittheilung von einem Geiste in Ohio vor.
Ein
anderes Mitglied schilderte die Ehe als die Wurzel alles Unheils; und
während
all dieser Wahnsinn vorgetragen wurde, sah man einzelne Männer und
Frauen, „die
eben mit ihrem Geiste in Widerspruch waren, sich wie Rasende geberden,
sich im
Kreisel drehen und die furchtbarsten Grimassen schneiden“. Der
Präsident
scheint noch der Vernünftigste gewesen zu sein, denn er hat zu
wiederholten
Malen dem tollen Treiben Einhalt zu thun. Vergebens. Die Geister
geberdeten
sich darum nur noch wüthender. Die Sitzung schloß wie sie angefangen
hatte. Die
Majorität der Geister scheint sich für den Weltuntergang ausgesprochen
zu
haben. Doch kam es zu keiner entscheidenden Abstimmung und die nächste
Versammlung auf den December angesagt.
Die
weite
Verbreitung von Verbrechen wurde
jedoch immer als Problem angesehen und sehr häufig beschrieben. Der
Stolz auf
die Freiheit in Amerika sei geradezu unbegründet, da die oberste Gewalt
in den
Händen von Verbrechern und Gesindel liege und dieser „Despotismus
(sei) schlimmer
als derjenige Rußlands oder Frankreichs“. (OLZ 204
v.1858/12/30)[42]
Aber auch Mordfälle, Lynchverfahren und Ähnliches entgingen nicht der Ironie:
„Oldenburger Zeitung“ No. 64 vom
26.04.1859
Amerika. – Newyork,
7.April […]
Der
„Nationalztg.“ wird aus Newyork
geschrieben: In manchen einzelnen Wochen geht es hier im Mordgeschäft
ziemlich lebhaft zu, wie nur etwa in London vor 50
oder 100 Jahren. Von Mittwoch den 30.März einschließlich sind hier in
der Stadt
Newyork nicht weniger als 16 Morde, Todtschläge oder Verwundungen durch
Stich-
und Schußwaffen weggekommen – macht jeden Tag im Durchschnitt zwei. Das
ist
freilich viel, indessen, wenn wir die Einwohnerzahl der Stadt in runder
Summe
auf 700.000 Seelen rechnen, bleiben doch noch immer 699.984 übrig, die
in
dieser Woche nicht ermordet, nicht erschlagen und nicht verwundet
worden sind.
So sehr lebensgefährlich ist es also immerhin nicht.
Als eine Ursache
hierfür wurde das
Justizwesen dargestellt. Ebenso wie die Politik erschien es korrupt,
chaotisch
und wenig effizient. Das politische Vorbild der Vereinigten Staaten
wurde zudem
durch den Umgang mit den Minderheiten in Frage gestellt. Spezifische
Modethemen
sind erkennbar: 1844 beispielsweise die europäischen Einwanderer, in
den 60er
Jahren die Sklaven und in den 70er Jahren zuerst die Indianer und dann
die
chinesischen Einwanderer.
„Oldenburgische Zeitung“ No. 64 vom
09.08.1844
Ausland
Cincinnati, 19.
Juli
(S.M.) Die Zwistigkeiten zwischen den National-Americanern und den
Irländern zu
Philadelphia hätten hier beinahe Veranlassung zu ähnlichen Auftritten
gegeben.
Statt der Irländer ist aber hier die Aufregung gegen die Deutschen
gerichtet,
welche fast den dritten Theil der Bevölkerung Cincinnati’s bilden und
von den
Natives längst mit neidischem Auge betrachtet wurden. Da sie aber
friedfertigerer Natur sind, als die Kinder Erins, und mehrere
wohlbewaffnete
und einexercirte Militaircompagnien auf den Beinen haben, so haben sich
ihre
Gegner noch nicht an sie gewagt. Es ist aber durchaus nicht
unwahrscheinlich,
daß es bei den nächsten Wahlen zu einem Ausbruch kommen wird. Man geht
jetzt
auch damit um, das Naturalisirungsgesetz aufzuheben und den irischen
und deutschen
Einwanderern das Stimmrecht zu entziehen. Nach der
Unabhängigkeitserklärung von
1776 sind zwar alle Menschen frei und gleich, aber man bleibt hier
lieber bei
der Theorie stehen, da man die Praxis etwas unbequem findet.
Ebenso
wie die
Vorliebe für Mordgeschichten
fällt die Häufigkeit von Berichten über Schiffs- und Eisenbahnunglücke,
Feuersbrünste, Epidemien und Klimakatastrophen auf, die als Indizien
für die
Oberflächlichkeit und den Leichtsinn der Amerikaner gesehen und als
Argumente
gegen die wirtschaftliche und vor allem technologische
Leistungsfähigkeit der
Vereinigten Staaten angeführt wurden.
„Oldenburger Zeitung“ No. 236 vom
10.10.1871
Vermischtes.
„Man hat jetzt“, schreibt
eine Newyorker Zeitung, „ein allerliebstes Spielzeug erfunden: es ist
dies ein
kleines Dampfschiff, welches, auf Wasser gesetzt, eine kleine Strecke
fährt,
dann mit einem gehörigen Knall explodiert und die Trümmer kleiner
Puppen dem
Beschauer ins Gesicht wirft. Durch dieses sinnreiche Spielzeug sollen
die
Kinder schon frühzeitig an dergleichen Unglücksfälle, die ihnen ja
täglich
passiren können, gewöhnt werden.“
„Oldenburger Zeitung“ No. 81 vom
23.05.1854
Vermischtes.
- Newyork,
30.April. Der Frühling bezeichnet heuer seinen Beginn mit furchtbaren
Stürmen. Noch treiben ein Menge Menschenleichen und Schiffstrümmer an
unsern
Küsten, noch ist nur ein Theil der 240 Unglücklichen aufgefunden, die
auf dem
„Powhattan“ von Havre nach Amerika fuhren und bei Long Beach
Schiffbruch
litten, als uns gestern ein Orkan, von einem heftigen Gewitter
begleiteter
Sturm heimsuchte.[…][43]
– Unsere Stadt ist übrigens in tiefer Trauer. Vom Cityhall, dem
Stadthause, und
andern öffentlichen Gebäuden wehen Flaggen, halbmasthoch aufgezogen.
Ein großes
feierliches Leichenbegängnis, das nächsten Sonntag Statt findet, wird
eine
große Anzahl unserer Bürger, die am 25. bei einer Feuersbrunst auf
Broadway ihr
Leben auf eine heldenmüthige Weise aufopferten, ehrenvoll zu Grabe
geleiten.
[…] Das Unglück, durch das unerwartete Einstürzen einer Mauer
veranlaßt, führte
auf den Leichtsinn und die Gewissenlosigkeit, mit welchen hier große
Gebäude
ohne hinlängliche Grundfesten und sonstige Vorsicht aufgeführt werden,
um ohne
Rücksicht auf die allgemeine Sicherheit so rasch als möglich der
Speculation zu
dienen. Diese gewissenlose Praxis wurde bei den Untersuchungen dieses
entsetzlichen Unglücks gebührend hervorgehoben, und es soll in Zukunft
der
unbeschränkten Freiheit der Bauführer ein Damm gesetzt werden. […]
Dennoch
wurde
auch hier mit viel Neid auf
die Vereinigten Staaten geblickt; z.B. in Bezug auf die Art und Weise, „wie man in Amerika Eisenbahnen baut“,
deren Effizienz zu einem Vergleich mit Deutschland einlud:
„Es
dürfte ein kleines interessantes Rechenexempel abgeben, wenn man nun
in Beziehung auf den Bau der Bremen-Heppenser Eisenbahn, als die uns
zunächst
liegende, fragt: Wie viel würden die Amerikaner nach obigen
Ausführungen Tage
gebraucht haben, um die genannte Linie fertig zu stellen und wie viel
hätte man
wohl Zeit gebraucht, um die Bahn nach dem Stillen Meere nach der bei
uns
üblichen Methode zu bauen? Um Antwort wird gebeten!“ (OLN 70 v. 1867/08/31)[44]
Auch die
Finanzentwicklung der Vereinigten
Staaten von 1846 bis 1855 führte dazu, daß diese als „der
glücklichste, gedeilichste, wohlgeordnetste Staat […], der mit
Grund von Europa nicht ohne gewisse Scheelsucht betrachtet wird“.
(VOL 90
v. 1855/08/01)
Immer neue und größere Goldfunde
sowie später die
entdeckten Öl-Vorkommen machten die Vereinigten Staaten zu einem
Synonym für
Reichtum. So betitelte „Der Beobachter“ einen Bericht über die
Möglichkeiten
der Moorkultivierung mit „Torf-Californien
oder Goldgruben im Moor“. (Beo 85 v. 1854/10/28)
Von „Millionären“
wurde berichtet, „die wie Pilze aus dem
Boden schießen“ (OLZ 47 v. 1867/02/25) und die keine anderen
Sorgen hätten
als ihr Geld auszugeben:
„Oldenburger Zeitung“ No. 293 vom
16.12.1864
Vermischtes.
* Ein
Brief
aus San Francisco im „Philadelphia
Demokrat“ schildert in ergötzlicher Weise, wie der plötzliche Reichthum
manche
Leute, die von ihm heimgesucht werden, in Verlegenheit bringt. „Einige
hundert
wohlgekleidete Männer, welche monatlich an 1000 bis 20.000 Dollars aus
ihren
Goldgruben beziehen, dämeln in der Stadt umher und wissen nicht, was
sie mit
sich anfangen sollen. Die meisten waren vormals Arbeiter, welche es
sich sauer
genug werden ließen. Jetzt fühlen sie sich im hohen Grade unbehaglich,
denn
seitdem sie die Schaufel und die Spitzhacke aus der Hand gelegt, haben
sie ein
ganz anderes Leben begonnen. Aber ihr größtes Unglück besteht darin,
daß sie
nicht wissen, wo sie ihr Geld los werden sollen. Allerdings trinken sie
den
besten Wein, rauchen die besten Cigarren, und speisen vortrefflich, das
Alles
kostet jedoch nicht viel. Aber in San Francisco giebt Geld allein noch
nicht
einem Manne den Anspruch auf Verkehr in der guten Gesellschaft und für
diese
fehlen ohnehin den meisten Neureichen die Vorbedingungen. Ein plötzlich
reich
gewordener Mann wird in den östlichen Staaten als ein Shoddy
bezeichnet, in Californien
aber als Washoe (nach den reichen Washoegruben). Vielen Leuten kann man
kein
anderes Verbrechen zum Vorwurf machen, als daß sie monatlich 10.000
Dollars
Einkünfte haben. Ich kenne Einen, den das Mißgeschick betraf, von
seinem
verstorbenen Bruder obendrein monatlich 12.000 Dollars zu erben, und er
ist
darüber untröstlich. „Was soll ich nun anfangen?“ sprach er. Ich
entgegnete:
„Kaufen Sie sich eine gute Bibliothek, kaufen Sie sich auch eine Yacht,
treiben
Sie Fischfang, werden Sie Jäger, machen Sie Reisen, lernen Sie andere
Länder
kennen, erfreuen Sie sich an der Kunst, namentlich an schönen Gemälden,
oder
bauen Sie sich ein schönes Haus und treiben Sie Landwirthschaft. Auf
solche
Weise können Sie sich die Zeit vertreiben.“ Der Unglückliche gähnte und
sprach:
„Das Jagen macht mir kein Vergnügen, auf das Fischen verstehe ich mich
nicht,
zum Ackerbau habe ich keine Lust, beim Lesen habe ich Langeweile und
ein
Gemäldekenner bin ich auch nicht.“ – Der Briefschreiber versichert, daß
er
diese Unterredung buchstäblich wiedergebe: er rieth dem Washoe – sich
zu
ersäufen, dann habe alle Qual ein Ende.
Dies hat
sicherlich bei einer Vielzahl von
Einwanderern allzu optimistische Vorstellungen vom schnellen Reichtum
ausgelöst. Die tatsächlichen Verhältnisse sowie die gesellschaftlichen
und
politischen Positionen der Deutsch-Amerikaner waren verständlicherweise
ein
Schwerpunkt der Zeitungen in ihren Berichten über die Vereinigten
Staaten und
vermutlich auch von besonderem Interesse für Auswanderungsaspiranten,
so dass
diesem Aspekt hier ein gesondertes Kapitel gewidmet wird.
Das
deutsche Element in Amerika
Der Begriff „Adoptivvaterland“ (OLZ 8 v. 1863/01/10) ist für das 19.Jahrhundert eine treffende Charakterisierung des Verhältnisses der Deutsch-AmerikanerInnen zu den Vereinigten Staaten. Wohl waren sie bemüht, schnell „gute Amerikaner“ zu werden, aber gleichzeitig behielten sie eine enge emotionale Bindung an Deutschland. Daß sich die jeweilige Selbstdefinition je nach den äußeren Verhältnissen ändern konnte, wird bei einem der prominentesten Deutsch-Amerikaner, Friedrich Hecker[45], deutlich. Bei der Betonung der Leistungen der Union während des Bürgerkrieges sprach er das „gewuchtige Wort […]: Ich bin ein Amerikaner!“ (OLZ 150 v. 1865/06/30)[46] Angesichts der deutschen Reichsgründung und des Sieges über Frankreich war er „als Deutscher mit Freude und Stolz erfüllt“. (OLZ 41 v. 1871/02/17)
Insbesondere bei letzterwähnter Gelegenheit, während des deutsch-französischen Krieges 1870/71, wurde die Bindung der Deutsch-AmerikanerInnen an das Stammvaterland deutlich. Die Loyalitäts- und Solidaritätsbekundungen reichten von aufmunternden Gedichten, Spendensammlungen und ausgelassenen Siegesfeiern[47] bis hin zur Rückkehr zwecks freiwilliger Kriegsdienstmeldung; letzteres allerdings nur sehr vereinzelt. Diese Haltung der doppelten Loyalität (dem Adoptivvaterland und dem Stammvaterland gegenüber) wurde erst unmöglich mit dem Eintritt der USA in den 1. Weltkrieg als Gegner Deutschlands (1917). Von diesem Zeitpunkt an kann auch erst von einer vollständigen Assimilierung der Deutsch-AmerikanerInnen gesprochen werden, auch wenn Die Deutschen in den Zeitungsberichten im 19.Jahrhundert regelmäßig als diejenige Einwanderer-Nationalität bezeichnet werden, die sich am schnellsten und gründlichsten amerikanisiert habe: „Wohin der Deutsche kam, fügte er sich […] in die Verhältnisse ein; so lange das heutige Newyork den Holländern gehörte, verwandelte er demüthig seinen deutschen Namen in einen holländischen, wie er ihn später dem Englischen anschmiegte.“ (OLZ 80 v. 1868/04/04)[48]
Dies mag auch hinsichtlich der Anpassung des Namens und der Färbung der Sprache zutreffen, eventuell auch hinsichtlich der Übernahme des Geschäftsgebarens der Amerikaner, aber andererseits gab es eine Vielzahl politischer und gesellschaftlicher Vereinigungen mit vielfältigen Bestrebungen zur Wahrung und Stärkung des deutschen Elementes in den Vereinigten Staaten. Zu deren, in den Zeitungen dokumentierten, Tätigkeiten gehörten Aktionen zur Einführung der deutschen Sprache als Unterrichtsfach[49], die Gründung deutscher Turnervereine oder ein plattdeutsches Volksfest:
„Oldenburger Zeitung“ No. 240 vom
14.10.1875
Das erste Plattdeutsche Volksfest
in Newyork.
Am
6-10.
September d.J. feierten in Newyork die Deutschen aus Norddeutschland
bekanntlich ein Erstes großes allgemeines Plattdeutsches Volksfest. Es
liegt
uns darüber der Bericht eines Oldenburger jungen Freundes vor, welcher
die
Reise von Baltimore nach Newyork mit einigen 80 anderen strammen
Burschen zu diesem
Fest unternahm. Das für dieses Fest aufgestellte Programm ist natürlich
nur mit
amerikanischem Maßstabe zu messen, es fehlt uns Europäern und
namentlich uns
Deutschen, für die Großartigkeit dieses Volksfestes vollständig der
Begriff.
Das Fest zur Einweihung des Hermanndenkmals im Teutoburger Walde,
welches wir
im verflossenen Sommer mitfeierten, und welches eine erkleckliche
Anzahl von
Menschen auf die Beine brachte, kann den Vergleich an versammelten
Menschenmassen und der entwickelten großartigen Pracht und Festlichkeit
nicht
im Entferntesten bestehen. – Da die Entfernungen für den Festzug,
welcher sich
am 6. Sept. durch die Straßen Newyorks bewegte, sich für eine Menge von
Theilnehmern zu groß erwiesen, waren für diese über 1000 offene
Droschken engagirt,
so daß auch weniger geübte Fußgänger sich an dem Zuge betheiligen
konnten.
Unsere Oldenburger Freunde, welche sich von B. aus einer größeren
Gesellschaft
junger Bremer angeschlossen hatten und unter Bremer Fahne fuhren,
erhielten
mehrfach, vermuthlich von Bremer Damen, große allmächtige
Blumenbouquets
zugeworfen und aus der Menge, die auf den Straßen dem Zuge zusahe,
erscholl zum
Oeftern der Zuruf „Da sind de Bremers! Hepp! Hepp!“ Nach zweistündiger
Fahrt
durch die Stadt kam man endlich an den Hudson, wo das Uebersetzen des
Zuges
nach Hoboken durch sieben der großen Dampfer vermittelt wurde. Es
fahren alle
drei Minuten solche Dampfer. Hier auf dem Festplatze fand die
Bewirthung statt
und zerstreute sich dann die Menge zu den allgemeinen Belustigungen,
wie sie
auch in kleineren Verhältnissen die Volksfeste in Deutschland bieten.
Am 3.
Tage des Festes wurde in einem deutschen Bauernhause, welches zu diesem
Zwecke
neu erbaut und Tags vorher eingeweiht war, eine Bauernhochzeit nach
deutschem
Brauch gefeiert. An diesem Tage sind über 70.000 Menschen auf dem
Festplatze
gewesen. Das Entree kostete 25 Cents. Das Comite soll so viel kleines
Papiergeld eingenommen haben, daß man dasselbe in kleine Kisten
verpacken
mußte, um es zu transportiren.
An
unsere
Oldenburger Landsleute erging in einem öffentlichen Blatt nachfolgende
Aufforderung zur Betheiligung an dieses Fest:
To dat Plattdütsche Volksfest
Schützenpark, Union Hill, N. J.,
an’n 6., 7., 8., 9. und 10 September.
Jungens, nu lat mal fast us tosamenstahn,
Un All‘ nah dat Plattdütsche Volksfest gahn,
Dat ward gewiß Keenen von Ju verdreten,
Mal wedder sin ollen Frünn‘ to begröten.
Van Jever, Butjadingen, Ammerland,
Van Oldenburg, wo wie jo All‘ bekannt,
Van Brake, Old Münsterland, Delmenhorst,
Gewiß, se kamt All‘ und stillt eren Dorst.
Un wat Good’s gift dar to trinken un äten,
Könnt singen un klönen und ok mal scheten,
Bi Krischan Büsing is’t Hauptquarteer,
Dar spält Harfenisten ’n Lustigen vör.
Die
deutschen
Einwanderer stellten zwar erst ab Mitte der 1870er Jahre die größte
Emigrantengruppe (zuvor waren dies die Iren: siehe oben die Graphik
„Immigranten in den USA 1850-1980“), aber schon zuvor gab es an vielen
Stellen
des ländlichen Mittleren Westen und westlich darüber hinaus, z. B. in
Nebraska,
nach dem „Philadelphia Democrat“ Regionen, in denen man einen „Dolmetscher“ benötigte, um sich als
Amerikaner zu verständigen. (OLZ 197 v. 1867/08/23) Auch andere Staaten
waren
beliebte Siedlungsgebiete der Deutschen: „Wenn
es so fortgeht […] so werden die Deutschen, welche jetzt schon die
Mehrheit
haben, zuletzt ganz Wisconsin in Beschlag nehmen.“ (OLZ 187
v. 1871/08/14)
In Cincinnati waren sie so zahlreich, dass es Stadtviertel namens
„Deutschland“
und „Rheinbezirk“ („Over the Rhine“) gab. Die meisten „deutschen“
(landwirtschaftlich geprägten) Siedlungen befanden sich in den West-
und
Mittelstaaten. Sie wurden durchgängig als besonders schön, besonders
gepflegt
und aufblühend geschildert. Und natürlich wurde auch ein
„Neu-Oldenburg“
gegründet[50]:
„Neue Blätter für Stadt
und Land“
No. 72 vom
06.09.1845
Kleine
Chronik
Neu-Oldenburg in Nordamerika. – Das „Wiskonsin-Banner“, die zu Milwaukin im Wiskonsin-Territorium erscheinende deutsche Zeitung, bringt in Nr.24 vom 15.Febr.d.J. folgende Nachricht:
„Im Washington-County wachsen jetzt die Städte wie Pilze aus der Erde; fast jede Woche bringt uns die Nachricht von einer neu angelegten Stadt. So sind seit kurzem am Cedar-Creek drei neue Städte entstanden; alles geht da mit Steam, und die Bewohner für diese Städte werden binnen Kurzem per Dampf anlangen. Die Namen der erwähnten Städte sind: Cedarburg, Neu-Oldenburg und Kerncastle. Ueber die beiden ersten können wir aus Mangel näherer Nachweise bis jetzt blos berichten, daß sie nahe bei einander ausgelegt sind, und daß die Herren Hilgen und Schröder in der zweiten eine große Mühle gebaut haben.“Dieses
Neu-Oldenburg wird von etwa 20-25 Butjadingern, größtentheils aus
Rodenkirchen,
Esenshamm und Blexen, gegründet sein. Nach Privatmittheilungen sind
alle
zufrieden und haben das feste Vertrauen, etwas vor sich bringen zu
können. Sie
finden sich leicht in die dort herrschenden freien Institutionen, doch
schreibt
kein Einziger, ohne mit der größten Innigkeit Alt-Oldenburgs zu
erwähnen.
Ein Spaßvogel will durch Taubenpost die Nachricht erhalten haben, daß die Gründer von Neu-Oldenburg die alt-oldenburgische Städte-Ordnung dort hätten einführen wollen, daß jedoch dies vom Gouvernement verboten wäre, weil – die erwähnte Städteordnung zu liberal wäre für Nordamerika.
 |  |
 |  |
| Karte von Ray Township in Franklin County/IN mit der Stadt Oldenburg (Beers, 1882). Gesamtansicht bei "Oldenburg in Amerika". | |
Entsprechend der beruflichen
Herkunft der Einwanderer
lebten die meisten
Deutsch-AmerikanerInnen auf dem Land und waren in der Landwirtschaft
tätig.[51]
In den Städten waren ganze Wirtschaftszweige in deutscher Hand,
insbesondere
die des Brauerei-Gewerbes und der Gaststätten. Diese Vorliebe der
Deutschen
wurde häufig angesprochen und war auch Ursache für Berichte über die
Schwierigkeiten, die es im Zusammenhang mit der Umsetzung der
sogenannten
Mäßigkeitsgesetze insbesondere mit den Deutsch-AmerikanerInnen gab:
„Oldenburger Zeitung“ No. 181 vom 05.08.1867
Amerika
Newyork,
20.Juli Die
Kämpfer für und gegen die strengen Gesetze in Betreff des Verkaufs
geistiger Getränke
stehen sich noch immer in ernster Fehde gegenüber, die nicht selten in
offenen
Conflict ausbricht. Nach den Bestimmungen müssen bekanntlich die Wirthe
und
Verkäufer an Sonntagen ihre Locale geschlossen halten und ist dann der
Verkauf
geistiger Getränke streng verboten. Das Verbot bezieht sich auch auf
die
Wochentage, nämlich auf die Stunden von Mitternacht bis
Sonnenaufgang.[…][52]
Die Deutschen, die auf Staaten Island am Sonntag sich so von den
Anstrengungen
ihrer Woche bei Lagerbier und den Klängen heimathlicher Lieder erholten
und zu
Hause fühlten, sind durch den Terrorismus besonders in ihren harmlosen
Vergnügungen gestört und nicht wenig erbittert, und werden das Gift,
das ihnen
die Machthaber des Staates ins Glas gegossen, wohl gelegentlich bei den
Wahlen
denselben wieder heimzahlen. In der Zwischenzeit kommt es zuweilen zum
Kampfe.
In den letzten Tagen zog Sonntags eine große deutsche Expedition mit
mächtigen
Vorräthen des beliebten Stoffes nach Staaten Island und begann sich
nach alter
Weise zu vergnügen. Aber das Auge des Gesetzes wachte und seine
Schergen
erhoben Einspruch, versuchten auch mit starker Hand das Getränke in
ihren
Besitz zu bringen. Dabei hatten sie aber die Rechnung ohne den Wirth
gemacht:
die Biertrinker erinnerten sich ähnlicher Störungen der Freiheiten im
Vaterlande und thaten, wie sie auch dort gethan, und eine gewaltige
Prügelei
erfolgte, wobei die Polizei schmählich den kürzeren zog.
Klagen, die Auswanderer in vielfältiger Form den daheim Gebliebenen vortrugen, umfassten nahezu sämtliche Lebensbereiche, angefangen von der Seekrankheit bei der Überfahrt bis hin zu den fehlenden Singvögeln in Amerika[54]. Insbesondere diejenigen Deutschen, die den Verlockungen der Werber erlagen und als „Kanonenfutter“ für die Armeen im Bürgerkrieg[55] oder als „Dutch-Niggers“ auf den Plantagen in den Südstaaten[56] endeten, hatten wohl Grund zu klagen. Trotzdem waren Berichte über völliges Scheitern und die Rückkehr in die Heimat eher selten.[57]
Überwiegend scheinen sich die deutschen Einwanderer sehr schnell etabliert zu haben, und von Seiten der „Native Americans“[58] wurden sie als die beliebteste Einwanderergruppe angesehen, insbesondere dank der deutschen Dienstmädchen[59] und dank des deutschen Bieres: „Der gebildete Amerikaner schwärmt für Lager und ist Mitglied eines deutschen Turn- und Gesangverein.[…] Durch das Lagerbier herrschen die Deutschen in der neuen Welt.“ (OLZ 53 v. 1860/04/03)
Zusammenfassung
der Merkmale in der Berichterstattung
Schon
infolge des sehr differenzierten Bildes, bei dem mitunter in einer
Zeitung und
am selben Tag (OLB 25.06.1833) sowohl ein sehr positiver als auch ein
äußerst
negativer Auswandererbrief abgedruckt wurde, läßt sich eine
nennenswerte
Einflussnahme der Berichterstattungen auf die Auswanderungsbewegung
nicht
bestätigen. Dies bemerkten auch die Zeitungen selbst:
„Oldenburgische Zeitung“
No.105 vom
31.12.1844:
„Das
Auswandern geht selbst mitten im Winter fort. In Antwerpen lagen
kürzlich 700
deutsche Auswanderer, die alle nach Texas wollten. Selbst die
Nachrichten von
untergegangenen Schiffen mit Auswanderern schrecken nicht ab.“
Insgesamt
fällt
bei der Untersuchung auf,
dass die Amerikaberichterstattung erst einsetzte, nachdem bereits viele
Auswanderer in die USA gegangen waren. In Zeiten, in denen andere
Themen in der
Berichterstattung vorherrschten, wurden Amerika und die Auswanderung
dorthin
eher vernachlässigt. Dies gilt beispielsweise während des Krieges
zwischen
Rußland und der Türkei 1828/29 und ganz besonders für das Jahr 1848, in
dem die
gesamte Auslandsrubrik zusammenschrumpft, zuerst zugunsten der
französischen
Revolution, dann mit Konzentration auf den deutsch-dänischen Krieg,[60]
um schließlich von der deutschen Revolution völlig verdrängt zu werden.[61]
Die
pauschale Aussage, dass die Presseberichterstattung eher auf die
Auswanderung
reagierte, als dass sie diese auslöste und förderte, ist somit
gerechtfertigt.
Auf
das
„Wie“ der Berichte hatten jedoch weder Zunahme noch Abnahme der
Auswanderung
einen prägenden Einfluss.
Es besteht ein
deutliches Übergewicht von
Meldungen über negative Ereignisse (Kriege, Epidemien, Unglücke etc.),
was
jedoch nicht überbewertet werden sollte, da dies für die gesamte
Berichterstattung galt und nicht auf Amerika beschränkt war. Ganz
offensichtlich war es nicht politisch motiviert, sondern folgte der
immer noch
gültigen Presseweisheit, dass eine schlechte Nachricht eine gute
Nachricht ist.
Auch die Häufung von Schauergeschichten in den ersten Jahrzehnten des
Untersuchungszeitraumes war ein Zugeständnis an den Geschmack des
Publikums und
eine journalistische Mode.[62]
Ebenso ist die Vorliebe für Kurioses und Glossen ein Merkmal der
Zeitungskultur. Hinsichtlich der Charakterisierung von Land und Leuten
der
Vereinigten Staaten haben diese aber eine hohe Aussagekraft. Auffällig
ist,
dass diese Anekdoten meist wenig präzise Hinweise auf Ort und Zeitpunkt
enthielten, und dass sie sich häufig nach einigen Jahren wiederholten.
In den
1860er Jahren nahm diese Form der Wahrnehmung der USA ab. Das ist auch
auf den
Wandel in der Presseberichterstattung
zurückzuführen.[63]
Die
Verwendung von Superlativen findet sich in nahezu allen
Themenbereichen; da war
die Rede von den höchsten Häusern, den längsten Flüssen, den riesigsten
Schiffen. Über vieles wurde mit Bewunderung berichtet, aber manches
erntete nur
Spott: der Blitzschlag, der ein ganzes Regiment getroffen und der Mann,
der
gleich drei Frauen seiner besten Freunde ver- und entführt habe: „Daß in Amerika Alles großartiger betrieben
wird als im altersschwachen Europa ist sattsam bekannt. […] Alles ist
großartig
und massenhaft!“ (OLZ 233 v. 1865/10/05)
Es
bestand
die Neigung, Nachrichten über die Vereinigten Staaten mit einem
hämischen bzw.
ironischen Unterton oder Nebensatz zu verbinden. Dies gilt insbesondere
für
Berichte, die sich mit den zivilisatorischen Missständen befassten, z.
B. mit
den Zuständen in San Francisco: „Die
Goldgräber fahren fort, glänzende Geschäfte zu machen, Indianer wie
Rothwild zu
jagen und gelegentlich sich durch mörderische Duelle Zeit und Leben zu
verkürzen.“ (OLZ 189 v. 1852/11/30)
Es
fällt
auf, dass so gut wie keine Artikel zu finden sind zu dem, was wir heute
mit dem
„Wilden Westen“ à la Karl May verbinden. D. h. es gibt so gut wie keine
Trapper- und nur wenige (romantische) Indianergeschichten. Nur sehr
selten
wurden die Wildnis, die Prärie und die Natur ausführlicher geschildert.
Zumeist
erwähnte man die Weite des Landes im Zusammenhang mit den
Siedlungsmöglichkeiten oder mit den Schwierigkeiten des Eisenbahn- oder
Telegrafenbaues, und man beschrieb dann auch die Flora und Fauna im
Kontext der
landwirtschaftlichen Bedingungen.[64]
Lediglich der Autor des Artikels „Das
große einsame Land“(OLZ 99-100 v. 1873/04/30)[65]
schwärmte ausführlich von dessen Weite und Schönheit; er meinte
allerdings
Kanada. Im Gegensatz dazu gibt es eine Vielzahl von
Stadtbeschreibungen, die
allesamt die Größe, den Verkehr, die Häuserhöhe, überhaupt die
Urbanität
bestaunten.[66]
Geht man also allein von den Zeitungsartikeln aus, dürfte der Kenntnisstand der deutschen Bevölkerung über die Vereinigten Staaten durchaus einseitig gewesen sein, wenn auch nicht „nahezu gleich Null“, wie der Autor des umfangreichen Artikels „Die Urtheile über Amerika“ (OLZ 197 v. 1856/12/14)[67] meinte. Bereits 1818 stellten die „Oldenburger Blätter“, die nicht unbedingt als „Gebildeten-Zeitung“ zu charakterisieren sind, die Rätselfrage: „Welcher bekannte Fluß besteht aus vier Sylben, und doch nur aus vier Buchstaben?“ (OLB 33 v. 1818/08/17) „Mississippi“ war die Antwort. Dies sowie die häufige Verwendung von Anglizismen sind zumindest Indizien für eine gewisse Vertrautheit mit dem Thema.
Dass allerdings in einem hohen Maße vereinfacht und pauschalisiert wurde, wird deutlich, wenn man liest, was den Autoren typisch amerikanisch zu sein schien.
Zum
Schluß: Typisch amerikanisch - damals wie heute
Das gilt
zum Beispiel für ein Beethovenjubiläum in New York, das in „grandioser Weise, aber wie immer, yankeeartig“
geplant wurde, d.h. in
einem zu diesem Event errichteten Gebäude mit einem
1000-Personen-Orchester
(OLZ 49 v. 1870/02/28), und als „Aecht
Amerikanisch“ gilt die
Erfindung eines Sicherheitssarges zur Vermeidung der Beerdigung von
Scheintoten. (OLZ 227 v. 1868/09/28).Zu „den
Dingen, die nur in Amerika möglich
sind, gehört die von San Francisco gemeldete Tatsache, daß ein
amerikanisches
Kriegsschiff Namens „Illinois“ aus einem amerikanischen Hafen gestohlen
worden
ist, ohne daß bis jetzt irgend Jemand etwas über den Verbleib desselben
hat
erfahren können.“ (OLZ 176 v. 1875/07/31). [eigene
Hervorhebungen]
Zwar
hatten nicht alle eine gar so schlechte Meinung von „den Amerikanern“
wie der
Autor des folgenden Briefes, aber dennoch sind einige Auszüge
charakteristisch:
„Oldenburgische Blätter“
No. 26 vom
25.06.1833
Ueber die Abnahme der physischen und
geistigen Kräfte in Amerika.
[…][68]
Alles
was wir
mit Lebensgenuß bezeichnen, ist dem Amerikaner fremd. Die Reize der
Tafel sind
ihm unbekannt, er ißt nur, um voll zu werden, verschlingt mit Hast,
spricht
nicht bey Tisch, springt auf vom Tisch wenn er voll ist, und geht
wieder woher
er kommt – to make money, um Geld
zu
machen.
Der
Amerikaner
ist von Temperament phlegmatisch, Nebenmischungen sind schwach, am
wenigsten
ist eine cholerische Mischung anzutreffen; er kennt keine Aufwallung
des Zorns.
Er ist nicht bloß phlegmatisch und leidenschaftslos, er ist mehr als
das, er
ist vollkommen apathisch. Seine intellectuellen Kräfte sind beschränkt,
er hat
lediglich einen mercantilisch speculativen Verstand. Sein Genie
beschränkt sich
bloß auf Technische, hierin ist aber auch seine ganze geistige Kraft
erschöpft.
Im Merkantilischen zeigt er eine ungemeine Schlauheit, keineswegs eine
umsichtige Klugheit und Gewandtheit. Er speculirt kleinlich, schmutzig,
und da
ihm das Gewissen fehlt, so wie alle höhere moralische Factoren der
Seele, so
ist er Betrieger, er betrügt wo er kann, im Großen und im Kleinen. Wenn
er auf
diese Weise viel Geld erworben hat, so ist er ein in der bürgerlichen
Gesellschaft geachteter Mann geworden; einzig und allein Geld erwirbt
hier
bürgerliche Achtung und Auszeichnung. Der Staatsmann, der Gelehrte,
wird
verachtet, alles Große und Schöne wird mit Füßen getreten.
[…]
Wenn
nun jene
mercantilische Speculation und der Sinn für Technik die einzigen
Resultate
eines geistigen Lebens der Amerikaner sind, so sind damit alle
geistigen
Functionen dieses Volkes erschöpft. Es hat für nichts weiter Sinn u.
Geistesthätigkeit. Ihm fehlt die Spann- u. Schwungkraft. Es hat keinen
Sinn für
Kunst, ahnet keine Dichtkunst, hat kein Gefühl für Musik.
[…]
Von dem
bisher
gesagten kann man auf den wissenschaftlichen Zustand dieses Volks im
Allgemeinen schließen; überall die größte Oberflächlichkeit. Kein
Amerikaner
geht in eine wissenschaftliche Unterhaltung ein. Wer wissenschaftliches
Interesse hat, befindet sich hier nicht besser, als bey den
Hottentotten.
Die
Kälte, die
sich im Aeußern dieses Volkes ausspricht, hat mich wegen des
Sittenzustandes
desselben lange im Irrthum erhalten; beym nähern Prüfen finde ich aber
die
Sittenlosigkeit größer als irgendwo. Weil der Amerikaner, vermöge
seiner
phlegmatischen, apathischen Natur sich in seiner Sinnlichkeit nicht zur
Leidenschaft hinreißen lassen kann, so fallen seine Laster nicht so
sehr ins
Auge. Weil überhaupt im Volke kein moralischer Werth vorhanden ist, so
giebt es
auch keine weibliche Tugend. […]
Lediglich
zur Bestätigung des repräsentativen Charakters (und zur Unterhaltung)
noch ein
paar Zitate über „die Amerikaner“:
„Der
Telegraph beschäftigt auch alle
Kanzelredner der Vereinigten Staaten. (Das ist doch wahrlich ein
Zeichen, daß
den Amerikanern der ihnen so oft abgesprochene ideale Sinn nicht fehlt, nur müssen
würdige
Gelegenheiten kommen, damit er sich äußere.)“
(VOL 69 v. 1858/08/28)
„Wiederrum
aber sind die
gebildeten
Americaner auch sehr fein, besonders die Damen […] Freilich ist der
gebildete
Theil des amerikanischen Publikums noch immer der kleinste […] Der
Americaner,
wenngleich Egoist, ist ein unternehmender und thätiger Mann […] in
allen Sachen
practisch […] sein Wahlspruch ist: Time is Money.“
(Beo 69-75 v. 1855/08/29)[69]
Anlässlich
eines zu Ehren des damaligen Präsidenten, mit dem Namen „Andy Johnson“
versehenen Preisochsen bemerkte die „Oldenburger Zeitung“ No. 91 vom
21.04.1866: „Der Amerikaner ist und
bleibt doch ein großes Kind, das von Takt so wenig versteht wie der
Mann im
Monde.“
Ebenfalls
im Stadium der „Kindheit“ befänden
sich aus europäischer Sicht die Wissenschaft und die Künste.[70]
Aber Kindheit heißt auch, dass in der Zukunft Aussicht auf Besserung
besteht,
und eben dies wurde den Frauen bescheinigt, denen zwar Verständnis und
Talent
für Kultur, Musik etc. weitgehend fehle, aber sie seien ja „lernfähig“.[71]
Die amerikanischen Frauen waren ein beliebtes Thema:
„Nachrichten für Stadt und Land“
No. 46 vom
20.04.1875
Rundschau.
- In Nordamerika reist ein geistvoller Deutscher – Friedrich Ratzel – umher, prüft die Leute und Zustände mit scharfem Auge und malt sie ab in der Köln. Zeitung. Er zerreißt schonungslos manchen Glorienschein und hat sich drüben sehr gefürchtet gemacht. In einem seiner letzten Briefe schildert er die amerikanischen Frauen. „Man nennt sie schön, sagt er, aber es ist eine sehr beschränkte Schönheit in diesen schmalen Gesichtchen mit den ungewöhnlich großen Augen, die uns glauben machen möchten, daß eine gewisse nervöse Aufgewecktheit die ruhig arbeitende, nach außen oft so unscheinbare Intelligenz ersetze. Wer näher zusieht, ist von der Flachheit und Seichtheit enttäuscht, die in der Mehrheit dieser niedlichen Köpfchen wohnt. Und der Körper? – Daß Gott erbarm‘! Man kann über solche Dinge nicht viel sprechen, doch ist eine noch weiter gehende Dürftigkeit in Masse und Kraft nicht zu denken. So schön die Gesichter, so häßlich diese kümmerlichen Leiber. Es ist bekannt, wie schlecht es bei den meisten Amerikanerinnen mit Zähnen und Haaren bestellt, ebenso, daß die Kunst, durch wattirte, aufgepuffte Kleider aus dem ärmlichen Geschöpf ein einigermaßen ansehnliches Püppchen zu machen, nirgends so weit gediehen ist. Aus demselben Grunde ist eine ungeschminkte Amerikanerin eine seltene Erscheinung. Daß nach Mittheilung zuverlässiger Aerzte wohl die Hälfte aller Mädchen an Störungen der wichtigsten Thätigkeiten des weiblichen Organismus leidet, ist nur einer der Ausflüsse ihrer zerrütteten Organisation. Es ist nothwendig, den schädlichen Einfluß hervorzuheben, den diese körperliche Heruntergekommenheit der Frauen auf die Ehe üben muß. Zahllose sind unfähig, sich den Pflichten der Familiengründung zu unterziehen, und der großen Mehrheit erscheinen dieselben als eine drückende Last, die das Leben verbittert. Von den Arbeiten, die bei uns selbst gutgestellte Frauen in Küche und Haus eigenhändig verrichten, weiß die Durchschnitts-Amerikanerin nichts oder wenig; sie sind entweder thatsächlich zu schwer für ihre Kräfte oder sie hält es unter ihrer Würde, sich denselben zu widmen.“ – Ein anderer amerikanischer Schriftsteller sagt über seine Landsmänninnen: „Unsere amerikanischen Frauen haben keine Lebenskraft. Sie sind Lilien, bleich, hübsch und vergänglich. Man heirathet eine Amerikanerin, und was heirathet man? Ein Kopfweh. Die englischen Mädchen sind doch wenigstens Rosen, die ihre Saison hindurch sich halten.“
Die
Wahrnehmung der Amerikanerinnen als empfindsame Modegeschöpfe war recht
durchgängig, es sei denn, sie gehörten zur
Frauen-Emanzipations-Bewegung; dann
waren sie eher „blue-stockings“ (OLZ
127 v. 1869/06/04), auf gut Deutsch gesagt: „Blaustrümpfe“.
Nimmt
man
obige Zitate für bare Münze, dann wären typische AmerikanerInnen des
19.Jahrhunderts egoistisch und pragmatisch, merkantil und
oberflächlich,
technikversessen und gigantomanisch, kulturlos und ungebildet,
leichtsinnig und
exzentrisch, freiheitsliebend und imperialistisch und überzeugt von der
Einzigartigkeit und der Überlegenheit des „American Way of Life“.
Diese Charakterisierung der USA und der AmerikanerInnen dürfte weitgehend dem heutigen Stereotyp entsprechen, nicht nur an Stammtischen. Eine Vielzahl der dokumentierten Artikel aus dem 19.Jahrhundert könnte ebenso, entsprechend sprachlich modernisiert, aus heutigen Zeitungen stammen. Das gilt insbesondere für Städtebeschreibungen und für Berichte über die heuchlerisch-puritanische Gesellschaft. Und wenn man die Erfolgsgeschichten der Kaufleute oder Goldsucher ein wenig umschreibt und z. B. den Namen Bill Gates einsetzt, besteht kaum noch ein Unterschied – und der Kommentar wäre wohl immer noch: „Typisch amerikanisch!“. Auch heute könnte die amerikanische Selbsteinschätzung von 1860 vielfache Zustimmung finden: „Daß wir eine große Nation sind weiß die ganze Welt“: schönste … größte … reichste … allerbest und allerschlechst … „die Lehrmeister der alten [heute: der ganzen] Welt“. (OLZ 85 v. 1860/05/31)[72]
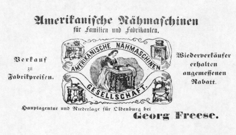 |
| Anzeige in der Oldenburger Zeitung (OLZ) vom 5. März 1866. |
Ob die USA allerdings noch das Land in der „Kindheit“ sind, dem damit dann auch die Zukunft gehört, mag bezweifelt werden. Trotzdem wären wohl die Vereinigten Staaten auch heute dasjenige Land, in das die meisten Deutschen, bei entsprechender ökonomischer und politischer Pression, auswandern würden, vorausgesetzt, sie bekämen eine Einwanderungserlaubnis, was eher unwahrscheinlich ist, da die USA heute, ebenso wie alle anderen Staaten, schon lange nicht mehr „für Alle offen“ sind.
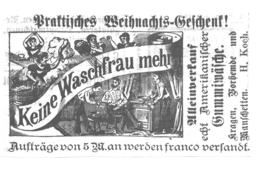 |
| Anzeige in der Vechtaer Zeitung vom 10. Dezember 1886 |
| [HOME - German] | [HOME - English] | [Datenschutz/Data Protection] |
| Forschungsstelle Deutsche Auswanderer in den USA - DAUSA * Prof.(pens.) Dr. Antonius Holtmann Brüderstraße 21 a -26188 Edewecht - Friedrichsfehn *Kontakt: antonius.holtmann@ewetel.net | ||